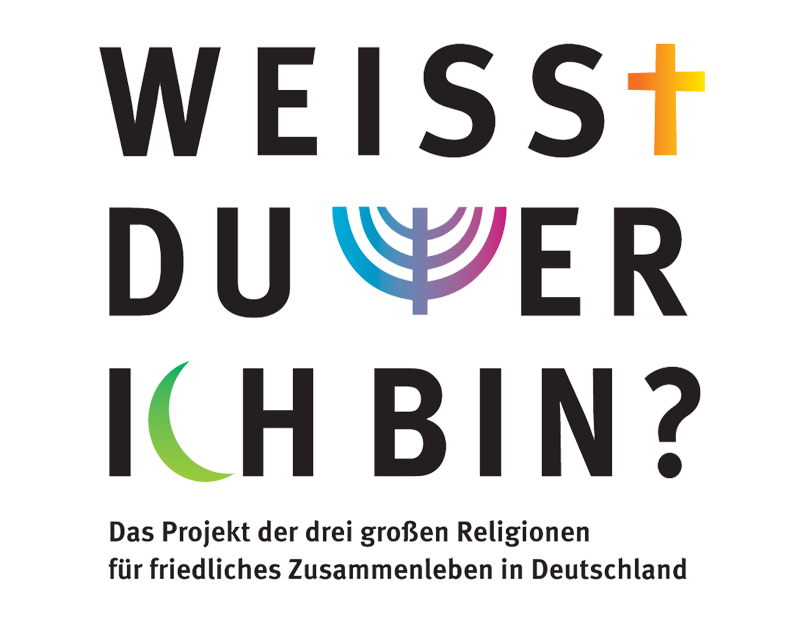Das Projekt ermöglicht damit auch die Rückfrage an alle, die sich mit dieser Ausstellung beschäftigen: „Was glaubst denn Du?“
So soll die gemeinsame wie persönliche Auseinandersetzung mit den Themen Religion, Sozialisation, Kultur, religiöse Vielfalt, Identität(en) durch niedrigschwellige Einblicke in reale Lebenswelten erleichtert werden. Zugleich lädt die Ausstellung dazu ein, Vorbehalte abzubauen, sowie gruppenbezogenen Stereotypisierungen und lebensweltliche Schranken zu überwinden.
Wir laden alle Interessierten ein, mutige Fragen zu stellen, neugierig zu werden, kritisch zu hinterfragen, sowie eigene Impulse mitzunehmen und weiterzutragen!
Wir freuen uns auf reges Anschauen, Ausleihen der Ausstellung und Herunterladen der Materialien.
Für Hinweise und Rückfragen sind wir dankbar und wünschen allen eine spannende, intensive Zeit mit dem Ausstellungsprojekt „Was glaubst denn du?“
Das Projekt ist aus der guten Zusammenarbeit der Projektpartner entstanden:
Die Realisation wurde durch die Förderung ermöglicht: